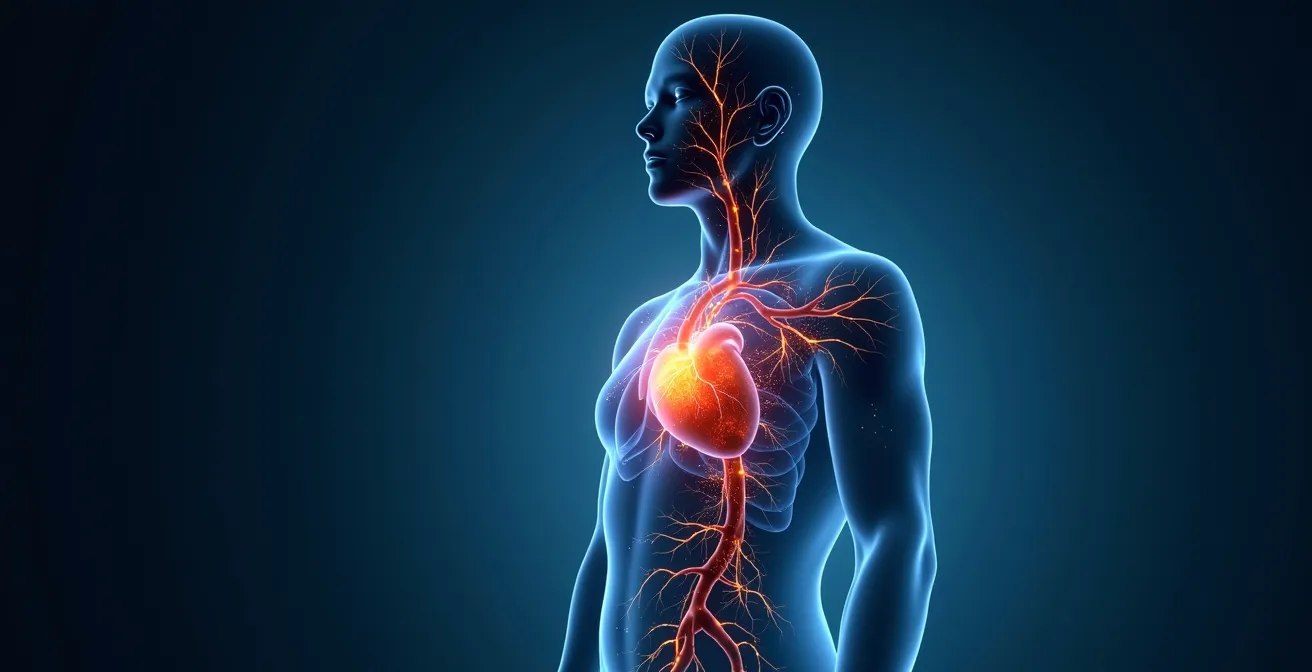
Der wahre Grund für viele Herzinfarkte ist nicht allein hohes Cholesterin, sondern eine stille, chronische Entzündung im Körper.
- Die wegweisende CANTOS-Studie beweist: Eine gezielte Entzündungshemmung senkt das Herzinfarktrisiko signifikant, selbst bei bereits gut eingestelltem LDL-Cholesterin.
- Der hochsensitive CRP-Wert (hs-CRP) ist der entscheidende Marker, um dieses verborgene „residuelle Entzündungsrisiko“ zu identifizieren und zu quantifizieren.
Empfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über einen hs-CRP-Test, um Ihr persönliches Entzündungsrisiko zu bestimmen. Dieses Risiko ist durch gezielte Maßnahmen oft besser steuerbar als genetisch bedingte Cholesterinwerte.
In meiner Praxis als Kardiologe treffe ich täglich Patienten, die ihre kardiovaskulären Risiken sehr ernst nehmen. Sie achten auf ihren Blutdruck, kennen ihren Cholesterinwert und bemühen sich um einen gesunden Lebensstil. Doch immer wieder sitzen verunsicherte Menschen vor mir, die trotz vorbildlicher LDL-Cholesterinwerte einen Herzinfarkt erlitten haben oder ein hohes Risiko dafür tragen. Sie fragen sich zu Recht: „Was habe ich übersehen? Was ist der fehlende Teil des Puzzles?“ Die Antwort darauf hat in den letzten Jahren die Kardiologie revolutioniert und unser Verständnis von Atherosklerose fundamental verändert.
Wir haben uns jahrzehntelang auf das Cholesterin als Hauptfeind unserer Gefäße konzentriert. Es ist unbestreitbar ein wichtiger Faktor, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Der entscheidende, oft übersehene Akteur ist eine chronische, niedriggradige Entzündung, die im Verborgenen schwelt – eine „stille Entzündung“. Dieses Phänomen ist kein bloßes Begleitsymptom, sondern ein eigenständiger und mächtiger Motor für die Entstehung und vor allem für die Destabilisierung von Gefäßablagerungen, den sogenannten Plaques. Eine bahnbrechende wissenschaftliche Untersuchung, die CANTOS-Studie, hat dies eindrucksvoll bewiesen und damit ein neues Kapitel in der Herzinfarktprävention aufgeschlagen: das Zeitalter der Immuno-Kardiologie.
Dieser Artikel dient als Ihr persönlicher Wegweiser durch dieses neue Paradigma. Ich werde Ihnen als Ihr behandelnder Kardiologe erklären, warum Entzündungsmarker wie das C-reaktive Protein (CRP) und Interleukin-6 (IL-6) mindestens genauso wichtig sind wie Ihr Cholesterinwert. Sie werden verstehen, wie diese Werte Ihr individuelles Risiko präzise abbilden und – das ist die wichtigste Botschaft – wie Sie dieses Risiko durch gezielte, alltagstaugliche Maßnahmen in Deutschland aktiv steuern können.
Um Ihnen einen klaren Überblick über dieses komplexe, aber entscheidende Thema zu geben, ist dieser Artikel strukturiert aufgebaut. Er führt Sie von den grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen bis hin zu konkreten Handlungsanweisungen für Ihren Alltag.
Inhaltsverzeichnis: Ihr Wegweiser zum Verständnis des Entzündungsrisikos
- Warum erleiden Menschen mit niedrigem Cholesterin trotzdem Herzinfarkte durch Entzündungen?
- Wie Sie Ihr CRP durch Ernährung in 8 Wochen in den Normalbereich bringen
- CRP oder hs-CRP: Welcher Wert ist für die Herzrisikobeurteilung relevant?
- Diese 5 unterschätzten Entzündungsquellen erhöhen Ihr Herzrisiko dauerhaft
- Wann sind entzündungshemmende Medikamente zur Herzinfarktprävention sinnvoll?
- Diese 5 Gewohnheiten beschleunigen Gefäßverkalkung um das Dreifache
- Wie hochsensitives Troponin Herzinfarkte 3 Stunden früher erkennt
- Arteriosklerose verhindern: Wie Sie Gefäßverkalkung aufhalten können
Warum erleiden Menschen mit niedrigem Cholesterin trotzdem Herzinfarkte durch Entzündungen?
Die Vorstellung, dass Atherosklerose lediglich eine „Verstopfung“ der Arterien durch Fett und Kalk ist, ist veraltet. Heute verstehen wir sie als einen aktiven, chronisch-entzündlichen Prozess. Cholesterin lagert sich zwar in der Gefäßwand ab und bildet Plaques, doch die wahre Gefahr geht von der Entzündungsreaktion aus, die diese Plaques hervorrufen. Immunzellen wandern in die Plaque ein, es werden entzündungsfördernde Botenstoffe (Zytokine) wie Interleukin-6 freigesetzt, und die Plaque wird instabil. Eine instabile Plaque kann plötzlich aufreißen (rupturieren), ein Blutgerinnsel bilden und so das Gefäß schlagartig verschließen – der Herzinfarkt oder Schlaganfall tritt ein.
Hier kommt das Konzept des „residuellen Entzündungsrisikos“ ins Spiel, das durch die CANTOS-Studie validiert wurde. Es beschreibt das Risiko, das auch dann noch besteht, wenn der LDL-Cholesterinwert durch Medikamente wie Statine bereits optimal gesenkt wurde. Dieses Restrisiko wird nicht durch Cholesterin, sondern durch die anhaltende Entzündung angetrieben. Genau das erklärt, warum Patienten trotz guter Blutfettwerte Ereignisse erleiden. Ihr „Feuer“ in den Gefäßen wurde nie gelöscht. Eine deutsche Studie, die umfangreiche Heinz Nixdorf Recall Studie an 4.814 Personen aus dem Ruhrgebiet, hat ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen, diese Zusammenhänge zwischen Entzündung, Verkalkung und Herzrisiko zu verstehen.
Der messbare Indikator für diese schwelende Entzündung ist das C-reaktive Protein (CRP). Wie von Diagnostik-Experten bestätigt wird, können bereits leicht erhöhte CRP-Werte (ca. 1–3 mg/L) auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Sie sind daher ein unverzichtbares Werkzeug, um das wahre Risiko eines Patienten zu erkennen und präventiv tätig zu werden, bevor es zu spät ist.
Wie Sie Ihr CRP durch Ernährung in 8 Wochen in den Normalbereich bringen
Die gute Nachricht ist: Gegenüber dem residuellen Entzündungsrisiko sind Sie nicht machtlos. Im Gegenteil, durch eine gezielte Ernährungsumstellung können Sie Ihren CRP-Wert oft innerhalb weniger Wochen signifikant senken. Eine antientzündliche Ernährung zielt darauf ab, dem Körper Stoffe zu liefern, die Entzündungsprozesse aktiv hemmen und gleichzeitig entzündungsfördernde Lebensmittel zu meiden. Es geht nicht um eine kurzfristige Diät, sondern um eine nachhaltige Anpassung Ihrer Essgewohnheiten.
Die Basis bilden Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und Ballaststoffen sind. Diese Nährstoffe greifen auf zellulärer Ebene in die Entzündungskaskade ein und helfen, das „Feuer“ in den Gefäßen zu drosseln. Die folgende Auswahl zeigt typische, in deutschen Supermärkten leicht erhältliche Lebensmittel, die das Fundament Ihrer antientzündlichen Ernährung bilden sollten.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, hier ein konkreter Plan, basierend auf Empfehlungen von Krankenkassen wie der IKK classic, den Sie über 8 Wochen umsetzen können, um Ihren CRP-Wert positiv zu beeinflussen:
- Omega-3-reiche Fische: Planen Sie zweimal wöchentlich Lachs, Hering oder Makrele ein.
- Buntes Gemüse: Integrieren Sie täglich mindestens fünf Portionen verschiedener Gemüsesorten wie Brokkoli, Paprika und dunkles Blattgemüse.
- Gesunde Fette: Verwenden Sie für Salate und kalte Speisen konsequent Leinöl, Rapsöl oder Walnussöl.
- Antioxidantien-Kraft: Bauen Sie täglich eine Handvoll Beeren (frisch oder tiefgekühlt) in Ihren Speiseplan ein, z.B. im Müsli oder als Snack.
- Darmgesundheit fördern: Fermentierte Lebensmittel wie frisches Sauerkraut, Joghurt oder Kefir unterstützen ein gesundes Darmmikrobiom, das eng mit dem Immunsystem verknüpft ist.
- Gewürze nutzen: Kombinieren Sie Kurkuma immer mit einer Prise schwarzem Pfeffer, um die Aufnahme des entzündungshemmenden Wirkstoffs Curcumin um ein Vielfaches zu steigern.
- Zucker und verarbeitete Lebensmittel meiden: Reduzieren Sie konsequent zugesetzten Zucker, Weißmehlprodukte und stark verarbeitete Fertiggerichte.
Die Wirksamkeit einzelner Komponenten ist gut belegt. So zeigt eine kalifornische Studie, dass bereits die tägliche Einnahme von 500 mg Vitamin C zu einer 24%igen Senkung des CRP-Wertes führen kann. Dies unterstreicht, wie stark die Ernährung Ihre Entzündungswerte beeinflussen kann.
CRP oder hs-CRP: Welcher Wert ist für die Herzrisikobeurteilung relevant?
Wenn wir über Entzündungswerte im Kontext des Herzrisikos sprechen, ist es entscheidend, zwischen zwei verschiedenen Tests zu unterscheiden: dem Standard-CRP und dem hochsensitiven CRP (hs-CRP). Während beide das gleiche Protein im Blut messen, ist ihr Anwendungsbereich fundamental verschieden. Der Standard-CRP-Test ist ein etablierter Marker für akute, starke Entzündungen, wie sie bei bakteriellen Infektionen oder rheumatischen Erkrankungen auftreten. Sein Messbereich ist darauf ausgelegt, hohe Werte zu erfassen und ist für die feine Abstufung im niedrigen Bereich ungeeignet.
Genau hier setzt der hs-CRP-Test an. Er wurde speziell entwickelt, um auch minimale, chronische Entzündungen im Bereich unter 10 mg/L mit hoher Präzision zu messen. Er ist das „Fein-Tuning-Instrument“ der kardiologischen Risikobewertung. Ein hs-CRP-Wert unter 1 mg/L gilt als niedriges Risiko, Werte zwischen 1 und 3 mg/L deuten auf ein mittleres Risiko hin, und Werte über 3 mg/L signalisieren ein hohes kardiovaskuläres Risiko – auch bei normalen Cholesterinwerten. In Deutschland ist der Standard-CRP-Test bei Verdacht auf eine akute Entzündung eine Kassenleistung, während der hs-CRP-Test zur Herzrisikobeurteilung in der Regel eine Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) ist, die vom Patienten selbst getragen wird.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede für Sie zusammen, um klarzustellen, warum für Ihr Herz nur der hs-CRP-Wert wirklich aussagekräftig ist.
| Merkmal | Standard-CRP | hs-CRP |
|---|---|---|
| Messbereich | Ab 5-10 mg/L | Ab 0,1 mg/L |
| Kosten in Deutschland | Kassenleistung | IGeL (15-25€) |
| Verwendung | Akute Entzündungen | Kardiovaskuläres Risiko |
| Risikobeurteilung | <1 mg/L: niedrig 1-3 mg/L: mittel >3 mg/L: hoch |
Spezifisch für Herzrisiko |
| Empfehlung DGK | Bei akuten Symptomen | Risikostratifizierung |
In der klinischen Praxis in Deutschland ist der hs-CRP-Test somit unverzichtbar geworden, um das Risiko von Patienten jenseits der klassischen Faktoren wie Cholesterin und Blutdruck zu bewerten. Wichtig ist dabei: Die Messung sollte immer in einer stabilen, infektfreien Phase erfolgen. Mindestens zwei Wochen Abstand zu einer Erkältung, einer anderen akuten Erkrankung oder auch einer Impfung sind notwendig, um eine fälschliche Erhöhung des Wertes zu vermeiden und ein aussagekräftiges Ergebnis für Ihr langfristiges Herzrisiko zu erhalten.
Diese 5 unterschätzten Entzündungsquellen erhöhen Ihr Herzrisiko dauerhaft
Eine antientzündliche Ernährung ist die Basis, doch oft wird übersehen, dass chronische Entzündungen auch aus ganz anderen Ecken unseres Körpers und Alltags stammen können. Diese „stillen Brandherde“ können Ihre Bemühungen durch gesunde Ernährung sabotieren, wenn sie nicht erkannt und adressiert werden. Als Ihr Kardiologe möchte ich Ihren Blick auf fünf oft unterschätzte, aber wissenschaftlich belegte Entzündungsquellen lenken, die Ihr Herzrisiko nachhaltig erhöhen können.
Das Bewusstsein für diese Faktoren ist der erste Schritt zur Kontrolle. Viele davon lassen sich durch präventive Maßnahmen und die Nutzung der in Deutschland verfügbaren Versorgungsstrukturen gut in den Griff bekommen. Der folgende Plan hilft Ihnen, diese versteckten Risiken systematisch zu überprüfen und anzugehen.
Ihr Aktionsplan: Versteckte Entzündungsherde aufspüren
- Mundgesundheit (Parodontitis): Chronische Zahnfleischentzündungen sind eine massive Quelle für Bakterien und Entzündungsbotenstoffe, die in den Blutkreislauf gelangen. Planen Sie zweimal jährlich eine professionelle Zahnreinigung. Viele Kassen wie die TK oder AOK erstatten Teile der Kosten.
- Darmgesundheit („Leaky Gut“): Eine durchlässige Darmschleimhaut kann dazu führen, dass unvollständig verdaute Nahrungsbestandteile und Toxine ins Blut übertreten und das Immunsystem chronisch aktivieren. Sprechen Sie Ihren Arzt auf die Möglichkeit eines Zonulin-Tests zur Diagnostik an.
- Chronischer Stress: Dauerstress führt zur Ausschüttung von Cortisol, was langfristig entzündungsfördernd wirkt. Nutzen Sie von Krankenkassen bezuschusste Präventionskurse nach § 20 SGB V, wie Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung.
- Luftverschmutzung: Feinstaub aus Verkehr und Industrie dringt tief in die Lunge ein und löst systemische Entzündungsreaktionen aus. Prüfen Sie die Luftqualitätsdaten des Umweltbundesamtes für Ihren Wohnort. In stark belasteten Gebieten kann ein HEPA-Luftfilter in der Wohnung sinnvoll sein.
- Schlafmangel und Schlafapnoe: Nächtliche Atemaussetzer (Schlafapnoe) führen zu Sauerstoffmangel und massivem Stress für den Körper, was die Entzündungswerte in die Höhe treibt. Suchen Sie bei Verdacht (lautes Schnarchen, Tagesmüdigkeit) ein zertifiziertes Schlaflabor auf; die Untersuchung ist eine Kassenleistung.
Die Relevanz dieser Faktoren ist keine bloße Theorie. Gerade der Zusammenhang von Umweltfaktoren und Herzgesundheit wurde in Deutschland umfassend untersucht. So konnte Die Heinz Nixdorf Recall Studie bestätigte signifikant erhöhte hs-CRP-Werte bei Anwohnern von stark befahrenen Straßen. Dies zeigt eindrücklich, wie direkt unser Umfeld die Entzündungsprozesse in unseren Gefäßen beeinflussen kann.
Wann sind entzündungshemmende Medikamente zur Herzinfarktprävention sinnvoll?
Wenn Lebensstiländerungen und eine antientzündliche Ernährung nicht ausreichen, um das Entzündungsrisiko, gemessen am hs-CRP-Wert, adäquat zu senken, rückt die medikamentöse Therapie in den Fokus. Hierbei gibt es jedoch wichtige Unterscheidungen und aktuelle Entwicklungen, die für Sie als Patient relevant sind. Es geht nicht darum, wahllos Entzungshemmer einzunehmen, sondern um eine gezielte, auf Ihr individuelles Risikoprofil abgestimmte Strategie.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse betrifft die Gruppe der Statine. Diese Medikamente sind primär als Cholesterinsenker bekannt, besitzen aber auch einen starken, davon unabhängigen entzündungshemmenden Effekt. Dieser sogenannte „pleiotrope Effekt“ ist der Grund, warum Statine auch für Patienten mit normalen Cholesterinwerten, aber einem deutlich erhöhten hs-CRP-Wert eine sinnvolle Therapieoption darstellen können. Sie bekämpfen das Problem an zwei Fronten gleichzeitig.
Statine haben nicht nur eine cholesterinsenkende, sondern auch eine potente entzungshemmende Wirkung, was erklärt, warum sie auch bei nur mäßig erhöhtem Cholesterin, aber hohem hs-CRP sinnvoll sein können.
– Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, DGK Leitlinien zur Statintherapie
Anders sieht die Situation bei niedrig dosierter Acetylsalicylsäure (ASS 100) aus. Lange Zeit wurde ASS zur Primärprävention – also bei Menschen ohne bekannte Herzerkrankung – empfohlen. Aktuelle Studien haben jedoch gezeigt, dass das erhöhte Risiko für schwere Blutungen (z.B. im Magen-Darm-Trakt) den potenziellen Nutzen bei vielen Patienten überwiegt. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DGK) hat sich daher der restriktiven Haltung der europäischen Leitlinien angeschlossen. In der Primärprävention wird ASS heute nur noch in sehr speziellen Hochrisikokonstellationen nach sorgfältigster individueller Abwägung eingesetzt. Für die Sekundärprävention, also nach einem Herzinfarkt, bleibt ASS hingegen ein unverzichtbarer Standard.
Die Entscheidung für oder gegen eine medikamentöse entzündungshemmende Therapie ist komplex und muss immer individuell durch Ihren behandelnden Arzt erfolgen. Sie hängt von Ihrem Gesamtrisiko, Ihren Begleiterkrankungen und Ihren Laborwerten ab.
Diese 5 Gewohnheiten beschleunigen Gefäßverkalkung um das Dreifache
Die Atherosklerose ist ein schleichender Prozess, der über Jahrzehnte andauert. Unsere täglichen Gewohnheiten haben einen immensen Einfluss darauf, wie schnell dieser Prozess voranschreitet. Bestimmte Verhaltensweisen wirken wie ein Brandbeschleuniger auf die chronische Entzündung und die damit verbundene Gefäßverkalkung. Oft sind es tief in unserer Kultur verankerte Routinen, die wir unhinterfragt übernehmen. Hier sind fünf der schädlichsten Gewohnheiten und konkrete, in Deutschland leicht umsetzbare Alternativen.
- Hoher Konsum von Wurst- und Fleischwaren: Stark verarbeitete Fleischprodukte sind reich an gesättigten Fettsäuren, Salz und entzündungsfördernden Stoffen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, den Konsum auf maximal 300-600 Gramm pro Woche zu beschränken. Ersetzen Sie Wurst auf dem Brot öfter durch pflanzliche Aufstriche oder Käse.
- Die „Kaffee und Kuchen“-Kultur mit Weißmehl: Der schnelle Anstieg des Blutzuckerspiegels durch Weißmehlprodukte und Zucker fördert Entzündungsprozesse. Statt zum klassischen Stück Torte greifen Sie lieber zu einem Stück Vollkorn-Roggenbrot mit Quark und frischen Früchten.
- Chronischer Bewegungsmangel: Regelmäßige Bewegung wirkt stark entzündungshemmend. Deutschland bietet mit seinem dichten Radwegenetz und über 90.000 Sportvereinen ideale Bedingungen. Schon 30 Minuten zügiges Gehen an fünf Tagen die Woche machen einen Unterschied.
- Rauchen: Jede einzelne Zigarette überflutet den Körper mit oxidativem Stress und Giftstoffen, die die Gefäßwände direkt schädigen und Entzündungen massiv fördern. Nutzen Sie die von allen Krankenkassen bezuschussten Raucherentwöhnungsprogramme. Es ist die wirksamste Einzelmaßnahme zur Herzinfarktprävention.
- Schlechte Schlafqualität: Dauerhaft zu wenig oder qualitativ schlechter Schlaf ist ein enormer Stressfaktor für den Körper und treibt die Entzündungswerte nach oben. Bei Schlafstörungen sind in Deutschland zertifizierte Schlaflabore (Kassenleistung) die richtige Anlaufstelle zur Abklärung.
Diese Gewohnheiten mögen harmlos erscheinen, aber in der Summe und über Jahre hinweg potenzieren sie sich zu einem erheblichen Risiko. Die Umstellung erfordert Disziplin, aber der Gewinn an Lebensjahren und Lebensqualität ist unbezahlbar. Jeder kleine Schritt in die richtige Richtung zählt und verlangsamt den Prozess der Gefäßverkalkung.
Wie hochsensitives Troponin Herzinfarkte 3 Stunden früher erkennt
Bisher haben wir über die langfristige Prävention gesprochen. Doch was passiert, wenn der Notfall eintritt? Bei akuten Brustschmerzen zählt jede Minute. Auch hier hat die Messung hochsensitiver Marker die Diagnostik revolutioniert. Der entscheidende Wert im akuten Geschehen ist das hochsensitive Troponin (hs-Troponin). Troponin ist ein Eiweiß aus dem Herzmuskel, das bei einer Schädigung – also einem Herzinfarkt – ins Blut freigesetzt wird. Frühere Tests konnten Troponin erst nach mehreren Stunden nachweisen.
Dank der hochsensitiven Assays können wir heute bereits winzigste Mengen an Troponin detektieren und einen Herzinfarkt viel früher diagnostizieren oder ausschließen. In den von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zertifizierten „Chest Pain Units“ (CPU), spezialisierten Notfallambulanzen in deutschen Krankenhäusern, sind standardisierte hs-Troponin-Algorithmen etabliert. Nach dem Notruf unter 112 und der Ankunft in der Klinik kann durch serielle Messungen des hs-Troponins (bei Aufnahme und nach 1-3 Stunden) ein Herzinfarkt mit extrem hoher Sicherheit bestätigt oder ausgeschlossen werden. Dieses Vorgehen rettet Leben, da eine schnelle Wiedereröffnung des verschlossenen Herzkranzgefäßes den Schaden am Herzmuskel minimiert.
Parallel zur Akutdiagnostik forscht die Immuno-Kardiologie an Frühwarnzeichen. Hier rückt ein weiterer Entzündungsmarker in den Fokus: Interleukin-6 (IL-6). Es ist ein zentraler Botenstoff, der die Leber zur Produktion von CRP anregt. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen ab 40 mit erhöhtem IL-6 ein signifikant höheres allgemeines Mortalitätsrisiko in den folgenden Jahren haben. IL-6 könnte sich somit als noch früheres Warnsignal für eine aus dem Ruder laufende systemische Entzündung etablieren, lange bevor ein akutes Ereignis eintritt.
Das Wichtigste in Kürze
- Chronische Entzündung ist ein vom Cholesterin unabhängiger, eigenständiger Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall.
- Der hochsensitive CRP-Test (hs-CRP) ist das entscheidende Instrument zur Messung dieses „residuellen Entzündungsrisikos“. Ein Wert über 3 mg/L signalisiert ein hohes Risiko.
- Eine antientzündliche Ernährung, Stressmanagement, ausreichend Schlaf und die Behandlung von Entzündungsherden (z.B. Parodontitis) sind die wirksamsten Maßnahmen zur Senkung des CRP-Wertes.
Arteriosklerose verhindern: Wie Sie Gefäßverkalkung aufhalten können
Die Verhinderung der Arteriosklerose ist ein lebenslanges Projekt, das auf zwei Säulen ruht: einem gesunden Lebensstil und einer proaktiven, intelligenten Vorsorge. Es geht darum, nicht erst zu handeln, wenn Symptome auftreten, sondern das individuelle Risiko frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Glücklicherweise stehen uns in Deutschland eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen zur Verfügung, die ein detailliertes Bild vom Zustand unserer Gefäße und unserem Risikoprofil zeichnen können.
Der „Check-Up 35“, der allen gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren alle drei Jahre zusteht, ist ein guter erster Schritt. Er erfasst jedoch oft nicht die spezifischen Entzündungsmarker. Daher ist es wichtig, die verfügbaren Optionen zu kennen, um im Gespräch mit Ihrem Arzt eine auf Sie zugeschnittene Vorsorgestrategie zu entwickeln. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Untersuchungen, ihre Aussagekraft und die Kostenübernahme in Deutschland.
| Untersuchung | Alter/Frequenz | Kostenträger | Aussagekraft |
|---|---|---|---|
| Check-Up 35 | Ab 35 Jahre, alle 3 Jahre | Kassenleistung | Basis-Screening |
| hs-CRP | Bei Risikogruppen | IGeL (15-25€) | Entzündungsrisiko |
| Koronarkalk-Score (CT) | Ab 40-45 bei Risiko | IGeL (80-400€) | Sehr hoch für Prognose |
| Carotis-Duplex (Ultraschall) | Bei Verdacht | Teilweise Kasse | Gefäßstatus der Halsschlagader |
| Lipoprotein(a) | Einmalig im Leben | IGeL (15-30€) | Genetisches Risiko |
Besonders der Koronarkalk-Score mittels Computertomographie (CT) hat sich als extrem aussagekräftig für die Prognose erwiesen. Er misst direkt die Menge an Kalk in den Herzkranzgefäßen und erlaubt so eine sehr genaue Risikoeinschätzung, die weit über die von Blutwerten hinausgeht. Wie der Leiter der Heinz Nixdorf Recall Studie es treffend formulierte, eröffnen sich hier neue Wege.
Die nicht-invasive direkte Darstellung der Koronargefäßverkalkung mittels CT eröffnet neue Möglichkeiten der Diagnostik und Früherkennung.
– Prof. Dr. Raimund Erbel, Heinz Nixdorf Recall Studie
Letztendlich ist die beste Strategie eine Kombination: Leben Sie bewusst und antientzündlich und nutzen Sie die modernen diagnostischen Möglichkeiten, um Ihr Risiko nicht nur zu schätzen, sondern zu kennen. Wissen ist der erste und wichtigste Schritt zur Macht über die eigene Gesundheit.
Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt oder Kardiologen über die in diesem Artikel besprochenen Entzündungsmarker und Vorsorgeoptionen. Eine proaktive Abklärung Ihres persönlichen Risikoprofils ist die beste Investition in eine lange und gesunde Zukunft für Ihr Herz.