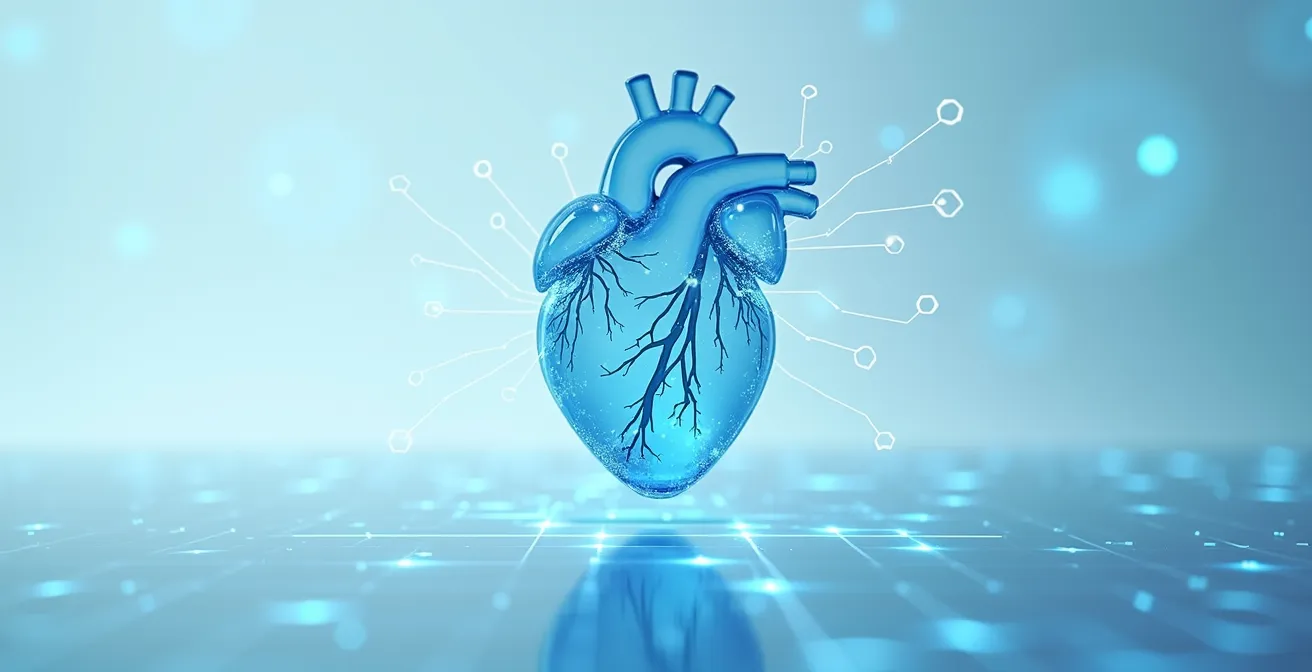
Entgegen der Sorge, die KI würde den Arzt ersetzen, ist das Gegenteil der Fall: Sie gibt ihm ein Super-Werkzeug an die Hand, um unsichtbare Risiken in Ihren Herzdaten zu erkennen, lange bevor Symptome auftreten.
- Künstliche Intelligenz analysiert das „Datenrauschen“ im EKG und findet darin prädiktive Signaturen für zukünftige Herzerkrankungen.
- Dieser Ansatz ermöglicht eine personalisierte Risikobewertung, die weit über traditionelle Methoden hinausgeht und die Therapieentscheidung verbessert.
Empfehlung: Sprechen Sie Ihren Kardiologen aktiv auf KI-gestützte Diagnoseverfahren an, um deren Vorteile für Ihre persönliche Vorsorge und Behandlung zu verstehen und zu nutzen.
Jeder Herzschlag ist eine komplexe Symphonie elektrischer Signale. Seit Jahrzehnten versuchen wir Kardiologen, aus dieser Musik – dem Elektrokardiogramm (EKG) – den Gesundheitszustand unserer Patienten abzuleiten. Wir suchen nach bekannten Abweichungen, nach den lauten, offensichtlichen Misstönen, die auf einen Herzinfarkt, eine Rhythmusstörung oder eine Herzschwäche hindeuten. Doch was ist mit den leisen, subtilen Dissonanzen, die wir mit bloßem Auge und Ohr übersehen? Was, wenn im Hintergrund eine Melodie spielt, die erst in Monaten oder Jahren zu einem ernsthaften Problem wird?
Die gängige Praxis stützt sich auf etablierte Verfahren wie Belastungs-EKGs, Herzultraschall oder Herzkatheteruntersuchungen. Diese Methoden sind reaktiv – sie finden meist Krankheiten, die bereits vorhanden sind. Doch die moderne Medizin steht an einer Schwelle. Die eigentliche Revolution liegt nicht darin, bestehende Diagnosen schneller zu stellen, sondern darin, Krankheiten vorherzusagen, bevor sie überhaupt klinisch relevant werden. Hier kommt die Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel, und sie verändert die Regeln fundamental.
Doch wenn wir über KI in der Herzmedizin sprechen, geht es nicht darum, den Arzt durch einen Algorithmus zu ersetzen. Der entscheidende Punkt, den viele übersehen, ist die Mensch-Maschine-Kollaboration. Die KI agiert wie ein Super-Mikroskop für Daten. Sie erkennt im gewaltigen Datenrauschen eines EKGs Muster, die für das menschliche Gehirn schlicht unsichtbar sind. Sie liefert uns eine völlig neue Informationsebene, eine Art Wettervorhersage für Ihr Herz. Die Aufgabe des Arztes wandelt sich: Er wird zum Interpreten dieser neuen Daten, zum Übersetzer zwischen der Wahrscheinlichkeit der Maschine und der Lebensrealität des Patienten.
Dieser Artikel führt Sie als Patient durch die faszinierenden und zugleich kritisch zu betrachtenden Möglichkeiten der KI in der deutschen Kardiologie. Wir werden beleuchten, wie Algorithmen verborgene Krankheiten aufspüren, Ihr persönliches Risiko berechnen und wo die unverzichtbare Rolle des menschlichen Experten beginnt und endet. Es ist eine Reise in die Zukunft der Herzmedizin, die für Sie bereits heute begonnen hat.
Um Ihnen einen klaren Überblick über dieses komplexe Thema zu geben, haben wir diesen Artikel in mehrere Kernbereiche unterteilt. Jede Sektion beantwortet eine zentrale Frage, die Sie als Patient direkt betrifft, von der Früherkennung bis hin zur Datensicherheit und den praktischen Anwendungen im deutschen Gesundheitssystem.
Sommaire: Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der modernen Kardiologie
- Warum erkennt KI im EKG Herzinsuffizienz, bevor Sie Symptome haben?
- Wie KI Ihr persönliches 5-Jahres-Herzrisiko aus 50 Datenpunkten berechnet
- KI oder Kardiologe: Wer stellt die präzisere Diagnose?
- Ihre Herzdaten in der Cloud: Wie sicher ist KI-Diagnostik datenschutzrechtlich?
- Wann wird KI-Diagnostik zum Standard in deutschen Herzzentren?
- Warum werden 15% der Herzerkrankungen initial falsch diagnostiziert?
- KI-Algorithmus oder Arzt: Wer trifft die bessere personalisierte Therapieentscheidung?
- Herz-Apps auf Rezept: Welche digitalen Anwendungen Ihre Krankenkasse bezahlt
Warum erkennt KI im EKG Herzinsuffizienz, bevor Sie Symptome haben?
Die Antwort liegt in der schieren Menge an Informationen, die ein Algorithmus verarbeiten kann. Während ein Kardiologe ein EKG nach bekannten, sichtbaren Mustern absucht, analysiert eine KI die zugrunde liegende Mikrostruktur der Daten. Sie lernt, Millionen von EKGs mit den dazugehörigen Krankheitsverläufen zu korrelieren. Dabei entdeckt sie extrem subtile, für den Menschen nicht wahrnehmbare „prädiktive Signaturen“ – winzige Abweichungen in der Signalform, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf eine sich anbahnende Erkrankung wie Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern hindeuten. So kann eine KI selbst in einem als „normal“ eingestuften EKG bereits die Vorboten einer Krankheit erkennen, Monate oder Jahre bevor der Patient erste Symptome wie Atemnot oder Müdigkeit verspürt.
Ein einziges EKG enthält mehr als 120.000 Datenpunkte.
– Dr. Philipp Breitbart und Prof. Dr. Thomas Arentz, Universitäts-Herzzentrum Freiburg/Bad Krozingen, HERZ heute 2/2025
Stellen Sie es sich wie das Erkennen eines Fingerabdrucks vor. Die KI lernt den einzigartigen „Fingerabdruck“ einer beginnenden Herzinsuffizienz. Eine bahnbrechende Studie des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) hat gezeigt, dass eine KI das biologische Alter eines Herzens anhand des EKGs bestimmen kann. Die Analyse ergab, dass Menschen, deren EKG-Alter ihr chronologisches Alter um mehr als acht Jahre überschreitet, ein signifikant höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Die KI erkennt also nicht die Krankheit selbst, sondern die Summe der minimalen Veränderungen, die ihr vorausgehen. Sie sieht die Alterung des Herzmuskels, bevor dieser seine Funktion spürbar einbüßt. Dieser prädiktive Ansatz ist ein Paradigmenwechsel: von der reaktiven Behandlung zur proaktiven Prävention.
Diese Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken, ist der Kernvorteil der KI. Sie ermöglicht es uns als Ärzten, frühzeitig präventive Maßnahmen einzuleiten, anstatt erst zu reagieren, wenn bereits irreparable Schäden am Herzen entstanden sind.
Wie KI Ihr persönliches 5-Jahres-Herzrisiko aus 50 Datenpunkten berechnet
Traditionelle Risikoberechnungen, wie der bekannte Framingham-Score, basieren auf einer Handvoll grober Parameter: Alter, Geschlecht, Cholesterinwerte, Blutdruck und Raucherstatus. Eine KI hingegen kann eine weitaus größere und vielfältigere Menge an Datenpunkten in ihre Analyse einbeziehen, um eine hochgradig personalisierte Risikoprognose zu erstellen. Sie verarbeitet nicht nur die klassischen Risikofaktoren, sondern auch subtile Informationen aus dem EKG, Daten aus der elektronischen Patientenakte, Laborwerte, genetische Marker und sogar Informationen aus tragbaren Geräten wie Smartwatches.
Der Algorithmus lernt aus den Daten von Millionen von Patienten, welche Kombinationen dieser 50, 100 oder sogar 1.000 Datenpunkte am stärksten mit dem Auftreten eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls in den nächsten fünf Jahren korrelieren. Die KI gewichtet diese Faktoren nicht statisch, sondern dynamisch und kontextabhängig. Eine leichte Blutdruckerhöhung mag für einen Patienten unbedeutend sein, in Kombination mit einer spezifischen, unauffälligen EKG-Veränderung und einem bestimmten Laborwert bei einem anderen Patienten jedoch ein Alarmsignal darstellen. Diese Fähigkeit, komplexe Wechselwirkungen zu erkennen, ist der entscheidende Vorteil gegenüber menschlicher Analyse.
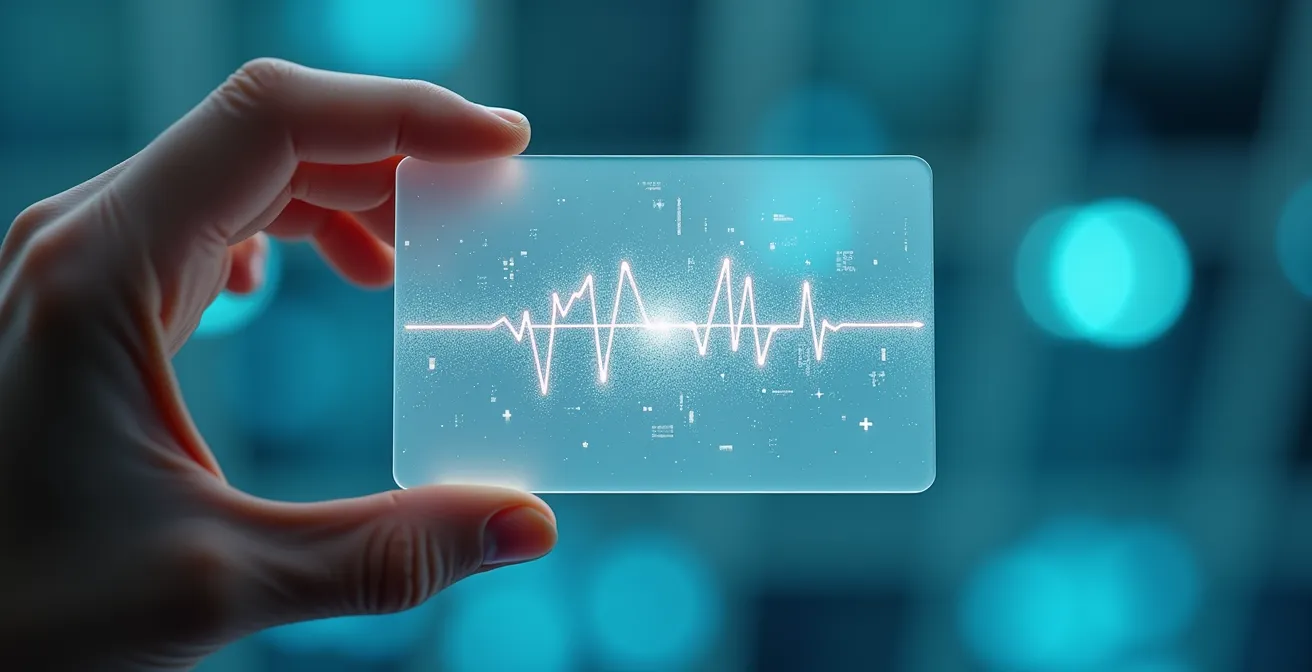
Wie die Forschung zeigt, steigt die Präzision der Vorhersage mit der Menge und Qualität der Daten. Werden beispielsweise mehrere EKGs eines Patienten über einen längeren Zeitraum analysiert, kann die KI Trends und Veränderungen erkennen, die in einer Einzelmessung verborgen bleiben. Dies führt zu einer deutlich genaueren Einschätzung des individuellen Risikos. Der Algorithmus erstellt so eine dynamische, atmende Risikoprognose, die sich mit neuen Datenpunkten kontinuierlich anpasst und verfeinert. Für Sie als Patient bedeutet das: Statt einer pauschalen Einordnung in eine Risikogruppe erhalten Sie eine wirklich personalisierte Vorhersage, die als Grundlage für eine maßgeschneiderte Präventionsstrategie dient.
Diese tiefgreifende Analyse ermöglicht es, präventive Therapien, wie die Gabe von Statinen oder Blutdrucksenkern, viel gezielter und nur bei den Patienten einzusetzen, die wirklich davon profitieren, und unnötige Behandlungen zu vermeiden.
KI oder Kardiologe: Wer stellt die präzisere Diagnose?
Diese Frage ist provokant, aber im Kern irreführend. Es geht nicht um ein „Entweder-oder“, sondern um ein „Sowohl-als-auch“. Die Stärke der KI liegt in der objektiven, unermüdlichen Mustererkennung in riesigen Datenmengen. Die Stärke des Kardiologen liegt im Verstehen des Kontexts, in der Empathie und der Fähigkeit, das individuelle Lebensumfeld des Patienten in die Diagnose einzubeziehen. Die Zukunft gehört der Symbiose aus beidem, der Mensch-Maschine-Kollaboration.
In spezifischen, klar definierten Aufgaben kann die KI dem Menschen jedoch bereits überlegen sein. Bei der Erkennung eines akuten Herzinfarkts im EKG etwa, wo jede Minute zählt, zeigen Studien beeindruckende Ergebnisse. So konnte eine Studie des Universitätsklinikums Düsseldorf nachweisen, dass ein KI-Algorithmus eine höhere Trefferquote bei der Infarkterkennung erzielte als menschliche Fachärzte. Die Maschine ist nicht durch Müdigkeit, Stress oder unbewusste Voreingenommenheit beeinflusst. Sie wendet ihr gelerntes Wissen mit konstanter Präzision an.
Dieser Geschwindigkeits- und Präzisionsvorteil hat direkte Auswirkungen auf die Patientenversorgung. Wie der bekannte Kardiologe Dr. Stefan Waller (Dr. Heart) in einem Podcast der Deutschen Herzstiftung berichtet, konnte durch die KI-basierte Auswertung des EKG ein Zeitgewinn von fast zehn Minuten bis zum lebensrettenden Eingriff im Herzkatheterlabor erzielt werden. Diese Minuten können über Leben, Tod und die spätere Lebensqualität entscheiden. Der Algorithmus alarmiert das Team, noch während der Patient im Rettungswagen ist, und ermöglicht eine optimale Vorbereitung der Klinik.
Dennoch bleibt die finale Entscheidung und die Verantwortung beim Arzt. Er muss das Ergebnis der KI validieren, es in den Gesamtkontext des Patienten einordnen und die Therapieentscheidung gemeinsam mit ihm treffen. Die KI ist ein brillantes Diagnoseinstrument, aber sie ersetzt nicht das ärztliche Gespräch und die menschliche Urteilskraft.
Ihre Herzdaten in der Cloud: Wie sicher ist KI-Diagnostik datenschutzrechtlich?
Die Sorge um die Sicherheit sensibler Gesundheitsdaten ist eine der größten Hürden bei der Akzeptanz von KI-Anwendungen in der Medizin – und das zu Recht. Wenn Ihr EKG oder Ihre Krankengeschichte in die Cloud geladen wird, um von einem Algorithmus analysiert zu werden, müssen höchste Sicherheitsstandards gelten. Glücklicherweise ist der rechtliche Rahmen in Deutschland und der EU durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einer der strengsten weltweit.
Für Sie als Patient sind vor allem zwei Prinzipien entscheidend: die Pseudonymisierung und die Zweckbindung. Pseudonymisierung bedeutet, dass Ihre persönlichen Identifikationsmerkmale (Name, Geburtsdatum) von Ihren medizinischen Daten getrennt werden. Der KI-Algorithmus arbeitet nur mit einem Code, der nicht direkt auf Sie zurückführbar ist. Nur autorisiertes medizinisches Personal in der Klinik kann diesen Code wieder mit Ihrer Person verknüpfen. Die Zweckbindung stellt sicher, dass Ihre Daten ausschließlich für den vereinbarten diagnostischen Zweck verwendet und nicht für andere Zwecke, wie etwa Werbung oder Versicherungsanalysen, missbraucht werden dürfen. Sie müssen der Nutzung Ihrer Daten explizit zustimmen und können diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Moderne technische Verfahren erhöhen die Sicherheit weiter. Anstatt alle Daten an einen zentralen Server zu senden, kommt zunehmend das „Federated Learning“ (verteiltes Lernen) zum Einsatz. Hierbei wird der KI-Algorithmus zu den Daten in die jeweilige Klinik geschickt, um dort zu lernen. Nur die anonymisierten Lernergebnisse werden zurück an einen zentralen Punkt gesendet, nicht aber die Rohdaten der Patienten. Ihre Daten verlassen also niemals die geschützte Umgebung des Krankenhauses. Seriöse Anbieter von KI-Diagnostik in Deutschland müssen diese strengen Auflagen erfüllen und werden durch Behörden wie den Bundesbeauftragten für den Datenschutz (BfDI) kontrolliert. Die Sicherheit Ihrer Daten ist keine Option, sondern eine gesetzliche und ethische Verpflichtung.
Auch wenn kein System eine 100-prozentige Sicherheit garantieren kann, ist das Schutzniveau für Gesundheitsdaten in zertifizierten medizinischen Systemen in Deutschland extrem hoch – oft höher als bei vielen kommerziellen Online-Diensten, die wir täglich nutzen.
Wann wird KI-Diagnostik zum Standard in deutschen Herzzentren?
Die KI ist längst keine ferne Zukunftsvision mehr; sie ist bereits in der klinischen Realität vieler deutscher Herzzentren angekommen, wenn auch oft noch im Rahmen von Studien oder spezialisierten Anwendungen. Die flächendeckende Integration in die Routinediagnostik ist jedoch ein Prozess, der von mehreren Faktoren abhängt: der technologischen Reife, der regulatorischen Zulassung, der Integration in bestehende Klinik-IT-Systeme und nicht zuletzt der Akzeptanz bei Ärzten und Patienten.
Der Druck zur Einführung wächst jedoch stetig, insbesondere angesichts des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen. KI-Systeme können Ärzte und Pflegepersonal von zeitaufwendigen Routineaufgaben entlasten, wie der initialen Auswertung von hunderten EKGs oder Herzultraschallbildern. Dieser Zeitgewinn, wie er bereits in der Akutversorgung eine enorm wichtige Rolle spielt, kann dann für das Wesentliche genutzt werden: das Gespräch mit dem Patienten. Die Technologie wird also nicht nur aus Gründen der diagnostischen Überlegenheit, sondern auch aus ökonomischer und organisatorischer Notwendigkeit zum Standard werden.
Führende Experten sind sich einig, dass der Wandel unumkehrbar ist. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann und wie schnell die breite Adaption erfolgt.
Wenn Ärzt*innen oder Kliniken die Möglichkeiten der KI nicht nutzen, werden sie in Zukunft den Anschluss verlieren – davon bin ich überzeugt.
– Prof. Dr. Alexander Meyer, Herzchirurg und Informatiker am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC)
Für einen vollständigen Übergang zum „Standard“ müssen die KI-Modelle jedoch eine strenge klinische Validierung und Zertifizierung als Medizinprodukt durchlaufen. Zudem müssen klare Abrechnungsmodelle mit den Krankenkassen etabliert werden. Experten gehen davon aus, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren die meisten kardiologischen Abteilungen in Deutschland auf KI-gestützte Systeme für spezifische Aufgaben wie die EKG-Analyse, die Bildauswertung oder die Risikostratifizierung zurückgreifen werden. Der Weg dorthin ist ein schrittweiser, aber konsequenter Prozess.
Als Patient werden Sie diesem Wandel also zunehmend begegnen. Es ist wichtig, dies nicht als Bedrohung, sondern als Chance für eine präzisere und vorausschauendere Medizin zu begreifen.
Warum werden 15% der Herzerkrankungen initial falsch diagnostiziert?
Die Zahl 15% ist eine oft zitierte Schätzung, die die Komplexität der kardiologischen Diagnostik verdeutlicht. Fehldiagnosen entstehen nicht zwangsläufig durch ärztliches Versagen, sondern oft durch eine Kombination aus untypischen Symptomen, überlappenden Krankheitsbildern und den Grenzen der traditionellen Diagnoseinstrumente. Ein Herzinfarkt bei einer Frau äußert sich beispielsweise oft anders als bei einem Mann – mit Übelkeit und Rückenschmerzen statt des klassischen Brustschmerzes. Solche atypischen Präsentationen können leicht fehlinterpretiert werden. Die Folgen können gravierend sein; in Deutschland gibt es laut Deutscher Herzstiftung durch plötzlichen Herztod über 65.000 Todesfälle pro Jahr, von denen einige möglicherweise durch eine präzisere Früherkennung vermeidbar wären.
Ein weiteres Problem ist die subjektive Komponente. Die Auswertung eines EKG-Streifens oder eines Ultraschallbildes hängt auch von der Erfahrung und Tagesform des Arztes ab. Hier liegt die große Chance der KI: ihre objektive und reproduzierbare Analyse. Sie bewertet jedes EKG nach den exakt gleichen, gelernten Kriterien, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Sie kann helfen, seltene Krankheitsbilder zu erkennen, an die ein Arzt im klinischen Alltag vielleicht nicht sofort denkt. Zudem erschließen sich durch KI völlig neue Diagnoseansätze, sogenannte „digitale Biomarker“. Forscher haben beispielsweise gezeigt, dass sich eine Herzinsuffizienz in subtilen Veränderungen der Stimme manifestieren kann. Ein KI-Algorithmus kann diese Veränderungen analysieren und als Frühwarnsystem dienen, oft bevor der Patient selbst eine Verschlechterung bemerkt.
Ihr Plan für das Arztgespräch über KI-Diagnostik
- Informationsgrundlage schaffen: Notieren Sie vorab, welche KI-Verfahren Sie interessieren (z.B. EKG-Analyse, Risiko-Score) und formulieren Sie konkrete Fragen zu deren Nutzen und Zuverlässigkeit in Ihrem Fall.
- Symptome und Daten sammeln: Führen Sie ein detailliertes Symptomtagebuch. Wenn Sie eine Smartwatch oder andere Gesundheits-Tracker nutzen, bringen Sie die aufgezeichneten Daten (z.B. Herzfrequenz, EKG-Aufzeichnungen) zum Termin mit.
- Offenheit für neue Methoden signalisieren: Fragen Sie Ihren Arzt direkt: „Setzen Sie in Ihrer Praxis bereits KI-gestützte Verfahren zur Diagnostik ein?“ oder „Wäre eine KI-Analyse meines EKGs eine sinnvolle Ergänzung?“
- Nach Grenzen und Alternativen fragen: Erkundigen Sie sich nach den Grenzen des vorgeschlagenen KI-Systems und fragen Sie, welche konventionellen Diagnosemethoden zur Absicherung der Ergebnisse herangezogen werden.
- Gemeinsame Entscheidung treffen: Verstehen Sie die KI als eine zusätzliche Informationsquelle. Treffen Sie die endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen gemeinsam mit Ihrem Arzt, basierend auf allen verfügbaren Fakten und seiner klinischen Einschätzung.
Die KI dient hier als Sicherheitsnetz. Sie kann den Arzt auf Unstimmigkeiten oder seltene Muster hinweisen und so die diagnostische Sicherheit signifikant erhöhen. Sie ist ein Werkzeug zur Reduzierung menschlicher Fehler und zur Erweiterung unserer diagnostischen Fähigkeiten.
KI-Algorithmus oder Arzt: Wer trifft die bessere personalisierte Therapieentscheidung?
Während die KI bei der reinen Diagnose bereits beeindruckende Fähigkeiten zeigt, ist die Therapieentscheidung eine ungleich komplexere Aufgabe. Hier geht es nicht nur um die Analyse von Daten, sondern auch um die Berücksichtigung der individuellen Lebensumstände, Werte und Wünsche des Patienten. Eine Maschine kann zwar die optimale medikamentöse Einstellung basierend auf Tausenden von Patientendaten vorschlagen, aber sie kann nicht beurteilen, ob ein 85-jähriger Patient die Nebenwirkungen einer aggressiven Therapie für einen potenziell geringen Lebenszeitgewinn in Kauf nehmen möchte. Diese Abwägung ist und bleibt eine zutiefst menschliche Aufgabe.
Die Rolle der KI in der Therapieplanung ist daher die eines intelligenten Beraters. Sie kann dem Arzt personalisierte Vorschläge unterbreiten, die auf den neuesten Studienergebnissen und den individuellen Patientendaten basieren. Beispielsweise kann ein Algorithmus vorhersagen, welcher Patient am ehesten von einem bestimmten Medikament profitieren wird oder bei wem ein hohes Risiko für Nebenwirkungen besteht. Diese „Entscheidungsarchitektur“ hilft dem Arzt, die Flut an medizinischen Informationen zu bewältigen und eine fundiertere Entscheidung zu treffen. Sie stellt sicher, dass keine relevanten Therapieoptionen übersehen werden.
Dieser Ansatz stärkt letztendlich die Arzt-Patienten-Beziehung. Prof. Holger Thiele, ein führender deutscher Kardiologe, bringt es auf den Punkt: KI-gesteuerte Programme verschaffen dem Arzt wertvolle Zeit. Diese Zeit, die nicht mehr für mühsame Datenanalyse aufgewendet werden muss, kann direkt in die Kommunikation mit dem Patienten fließen. Das persönliche Gespräch, das Erklären von Optionen und das gemeinsame Festlegen von Therapiezielen – diese Aspekte der Medizin sind durch keine Maschine ersetzbar. Die KI erledigt die Rechenarbeit, der Arzt widmet sich dem Menschen.
Die bessere personalisierte Therapieentscheidung trifft also weder die KI noch der Arzt allein, sondern das Team aus beiden. Die KI liefert die datengestützte Wahrscheinlichkeit, der Arzt liefert die klinische Weisheit und die menschliche Empathie.
Das Wichtigste in Kürze
- Die Stärke der KI in der Kardiologie liegt darin, unsichtbare Muster im „Datenrauschen“ von EKGs zu erkennen und so Krankheiten vorherzusagen, bevor Symptome auftreten.
- Sie ermöglicht eine hochgradig personalisierte Risikobewertung, die weit über traditionelle Methoden hinausgeht und als Basis für maßgeschneiderte Prävention dient.
- KI ist kein Ersatz, sondern ein intelligentes Werkzeug für den Arzt. Sie steigert die diagnostische Präzision und schafft mehr Zeit für die essenzielle Arzt-Patienten-Kommunikation.
Herz-Apps auf Rezept: Welche digitalen Anwendungen Ihre Krankenkasse bezahlt
Die Digitalisierung der Herzmedizin findet nicht nur in Herzzentren statt, sondern auch direkt auf Ihrem Smartphone. Mit den „Digitalen Gesundheitsanwendungen“ (DiGA), oft auch „Apps auf Rezept“ genannt, hat Deutschland einen weltweit einzigartigen Weg geschaffen, um geprüfte und wirksame Gesundheits-Apps in die Regelversorgung zu integrieren. Diese Apps sind zertifizierte Medizinprodukte, deren Kosten von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.
Im Bereich der Kardiologie können DiGAs vielfältige Aufgaben übernehmen. Sie helfen Patienten mit Vorhofflimmern, ihre Medikamenteneinnahme zu managen und EKG-Aufzeichnungen via Smartwatch zu dokumentieren. Bei Bluthochdruck unterstützen sie durch die Überwachung der Werte und geben personalisierte Tipps zu Lebensstiländerungen. Für Patienten mit Herzinsuffizienz können sie als digitales Tagebuch dienen, um Symptome wie Gewichtszunahme oder Atemnot zu protokollieren und bei Verschlechterung frühzeitig Alarm zu schlagen. Aktuell sind laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) bereits eine Vielzahl von DiGAs zugelassen, deren Zahl stetig wächst. Stand Juni 2024 wurden bereits 55 DiGA positiv beschieden und sind damit erstattungsfähig.
Der Weg zu einer solchen App ist unkompliziert. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, eine DiGA zu erhalten, die von Ihrer Krankenkasse bezahlt wird.
| Weg zur DiGA | Vorgehensweise | Voraussetzung |
|---|---|---|
| Ärztliche Verordnung | Arzt/Psychotherapeut stellt Rezept (Formular 16) aus | Medizinische Indikation liegt vor |
| Direktantrag bei Krankenkasse | Patient stellt Antrag direkt bei seiner Kasse | Nachweis einer ärztlich bestätigten Indikation |
Sprechen Sie Ihren Kardiologen oder Hausarzt aktiv auf die Möglichkeit einer DiGA an. Diese digitalen Werkzeuge können eine wertvolle Ergänzung Ihrer Therapie sein, Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Erkrankung geben und die Kommunikation mit Ihrem Behandlungsteam verbessern.