
Entgegen der Annahme, der „Check-up 35“ biete umfassende Sicherheit, ist er oft nur der Ausgangspunkt einer sinnvollen Herzvorsorge – die entscheidenden Risiken bleiben häufig unentdeckt.
- Die Standardvorsorge der Krankenkassen deckt wichtige Basiswerte ab, erfasst aber genetische Risiken wie Lipoprotein(a) oder den Zustand der Gefäße unter Belastung nicht.
- Ihre persönliche und familiäre Vorgeschichte ist der wichtigste Kompass, um notwendige Zusatzuntersuchungen (IGeL) von überflüssigen zu unterscheiden.
Empfehlung: Werden Sie vom passiven Patienten zum aktiven Gesundheitspartner, indem Sie gezielte Fragen stellen und Ihren individuellen Vorsorgeplan gemeinsam mit Ihrem Arzt gestalten.
Jeder gesetzlich Versicherte in Deutschland kennt ihn: den Anspruch auf den „Check-up 35“. Alle drei Jahre ein kurzer Besuch beim Hausarzt, Blutabnahme, Urinprobe, Blutdruckmessung – ein beruhigendes Ritual, das suggeriert, alles sei in Ordnung. Doch die Realität zeichnet oft ein anderes Bild. Viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln sich schleichend und unbemerkt über Jahre hinweg. Sie verursachen erst dann Symptome, wenn bereits irreversible Schäden entstanden sind. Die Standard-Vorsorgeuntersuchung ist eine wichtige Säule, aber sie kann eine trügerische Sicherheit vermitteln.
Die gängige Meinung ist, dass die von den Krankenkassen bezahlten Leistungen ausreichen, um die eigene Herzgesundheit im Blick zu behalten. Oft werden weiterführende Untersuchungen, die sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), pauschal als unnötige Geldschneiderei abgetan. Doch die Wahrheit liegt, wie so oft in der Medizin, in der Mitte. Die entscheidende Frage ist nicht, *ob* man mehr tut als den Standard, sondern *was* man individuell und risikoadaptiert tun sollte. Die eigentliche Kunst der Prävention liegt darin, die Lücke zwischen der pauschalen Kassenleistung und der personalisierten, wirklich sinnvollen Diagnostik zu schließen.
Dieser Leitfaden verfolgt daher einen anderen Ansatz. Anstatt nur aufzuzählen, was die Kasse zahlt, agiert er als Ihr „Übersetzer“ und strategischer Berater. Er zeigt Ihnen, wo die Grenzen des Check-up 35 liegen und wie Sie als informierter Patient die richtigen Fragen stellen können. Es geht darum, gemeinsam mit Ihrem Arzt eine risikoadaptierte Strategie zu entwickeln, die auf Ihrer persönlichen Geschichte basiert. Sie lernen, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu verstehen, welche Untersuchung für Sie persönlich den größten Nutzen bringt, um Ihr Herz langfristig gesund zu halten.
Um Ihnen eine klare Orientierung zu geben, beleuchtet dieser Artikel die verschiedenen Facetten der Herzvorsorge Schritt für Schritt. Wir beginnen mit den verborgenen Risiken, die oft übersehen werden, und führen Sie durch die optimalen Strategien und spezifischen Untersuchungen, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Inhaltsverzeichnis: Herzvorsorge in Deutschland: Ein umfassender Wegweiser
- Warum entdecken 60% der Herzpatienten ihre Erkrankung erst nach dem ersten Infarkt?
- Wie Sie den Check-up 35 optimal für Ihre Herzgesundheit nutzen
- Belastungs-EKG, Herzultraschall oder Herz-CT: Welche Untersuchung zeigt was?
- Die unterschätzte Gefahr: Warum Männer ab 45 das Belastungs-EKG nicht auslassen sollten
- In welchen Abständen sollten Sie Ihre Herzwerte kontrollieren lassen?
- Wie Sie sich auf Ihr Belastungs-EKG richtig vorbereiten: Die 6 wichtigsten Regeln
- Wie läuft eine Echokardiographie ab und müssen Sie sich vorbereiten?
- Wie hoch ist Ihr Herzinfarkt-Risiko: So berechnen Sie es mit dem PROCAM-Score
Warum entdecken 60% der Herzpatienten ihre Erkrankung erst nach dem ersten Infarkt?
Die Vorstellung ist beunruhigend: Ein Herzinfarkt oder eine andere schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung tritt scheinbar aus heiterem Himmel auf, obwohl man regelmäßig zur Vorsorge ging. Dieses Phänomen ist leider keine Seltenheit und hat tiefere Ursachen, die in den Grenzen unseres Vorsorgesystems liegen. Das Hauptproblem ist eine gefährliche „Vorsorgelücke“: Die Standarduntersuchungen suchen nach bereits manifestierten Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder erhöhtem Cholesterin, aber nicht konsequent nach der stillen, schleichenden Gefahr der Atherosklerose – der Gefäßverkalkung, die sich über Jahrzehnte entwickelt.
Ein entscheidender Grund dafür ist die mangelnde Ausschöpfung der bestehenden Angebote. So nehmen laut einer Studie des Robert Koch-Instituts nur etwa die Hälfte der Berechtigten den Check-up 35 überhaupt wahr. Viele wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie keine Symptome spüren. Doch genau hier liegt die Tücke: Die koronare Herzkrankheit (KHK) ist eine stille Gefahr. Zusätzlich werden genetische und oft unerkannte Risikofaktoren im Standard-Check nicht erfasst. Dazu gehören insbesondere:
- Lipoprotein(a) [Lp(a)]: Ein Blutfettwert, dessen Höhe fast ausschließlich genetisch bedingt ist und der das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall stark erhöhen kann. Er ist nicht im Standard-Lipidprofil enthalten.
- Familiäre Vorbelastung: Herzerkrankungen bei nahen Verwandten vor dem 60. Lebensjahr sind ein starkes Alarmsignal, das eine intensivere Diagnostik erfordert.
- Geschlechtsspezifische Symptome: Besonders Frauen zeigen oft untypische Anzeichen eines Herzinfarkts wie Übelkeit oder Rückenschmerzen, die fehlinterpretiert werden.
- Psychosozialer Stress: Chronischer Stress ist ein anerkannter Risikofaktor, der sich aber nicht in einem einfachen Blutwert messen lässt.
Die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Leitlinien und der Praxis ist erheblich. Christoph Altmann vom Landesverband Sachsen der DGPR (Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen) bringt es auf den Punkt:
Wir gehen davon aus, dass die Empfehlung der Europäischen Gesellschaft in Deutschland praktisch überhaupt nicht umgesetzt wird
– Christoph Altmann, Landesverband Sachsen der DGPR
Diese Aussage bezieht sich auf die Bestimmung des Lp(a)-Wertes – ein perfektes Beispiel für die Lücke zwischen dem, was medizinisch sinnvoll wäre, und dem, was im Alltag der Kassenpraxen umgesetzt wird. Solange diese stillen Gefahren nicht systematisch gesucht werden, bleibt die Vorsorge ein Netz mit zu großen Maschen.
Wie Sie den Check-up 35 optimal für Ihre Herzgesundheit nutzen
Der Check-up 35 ist weit mehr als eine passive Pflichtübung – er ist Ihre beste Gelegenheit, zum informierten Partner Ihres Arztes zu werden. Anstatt den Termin nur über sich ergehen zu lassen, sollten Sie ihn aktiv gestalten. Die größte Wertschöpfung entsteht nicht durch die Blutabnahme selbst, sondern durch das Gespräch, das Sie vorbereitet führen. Ihr Ziel sollte es sein, über die Standard-Parameter hinauszublicken und Ihr persönliches Risikoprofil zu schärfen. Nutzen Sie die Zeit, um die „Vorsorgelücke“ anzusprechen und gemeinsam zu entscheiden, ob zusätzliche Untersuchungen für Sie sinnvoll sind.
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) übernehmen ab 35 Jahren alle drei Jahre die Kosten für den Basis-Check, der eine körperliche Untersuchung, die Messung von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterinwerten (Gesamtcholesterin, LDL, HDL, Triglyceride) sowie eine Urinuntersuchung umfasst. Seit 2018 ist auch ein einmaliges Screening auf Hepatitis B und C Teil des Programms. Alles, was darüber hinausgeht, fällt in den Bereich der Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die Sie selbst bezahlen müssen – es sei denn, es liegt ein konkreter Krankheitsverdacht vor. Wie eine Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums zeigt, gehören dazu etwa die wichtige Bestimmung des Lipoprotein(a)-Wertes oder erweiterte Blutanalysen.
| Untersuchung | Kassenleistung ab 35 | IGeL-Leistung | Kosten als IGeL |
|---|---|---|---|
| Basis-Check | ✓ Alle 3 Jahre | – | – |
| Lipidprofil | ✓ Inklusive | – | – |
| Hautkrebs-Screening | ✓ Alle 2 Jahre | – | – |
| Lipoprotein(a) | Nur bei Indikation | ✓ | 20-40€ |
| Erweiterte Blutanalyse | – | ✓ | 50-100€ |
Um dieses Gespräch optimal vorzubereiten, ist eine strukturierte Herangehensweise entscheidend. Betrachten Sie den Arztbesuch wie ein wichtiges Meeting, für das Sie eine klare Agenda haben. Notieren Sie Ihre Familiengeschichte, aktuelle Beschwerden und vor allem Ihre Fragen im Voraus.
Ihr Aktionsplan für das Arztgespräch: Die entscheidenden Punkte für Ihre Herzgesundheit
- Ausgangslage klären: Listen Sie alle bekannten Herzerkrankungen in Ihrer direkten Familie (Eltern, Geschwister) auf, insbesondere wenn diese vor dem 60. Lebensjahr auftraten.
- Bestehende Daten sammeln: Bitten Sie Ihren Arzt um eine Kopie Ihrer aktuellen und vergangenen Laborergebnisse, um Verläufe nachvollziehen zu können.
- Lücken identifizieren: Fragen Sie gezielt nach der „Vorsorgelücke“. Sprechen Sie Themen wie Lipoprotein(a) an und erkundigen Sie sich, ob Sie ein Kandidat für ein Belastungs-EKG als Kassenleistung sind.
- Relevanz bewerten: Diskutieren Sie die Sinnhaftigkeit von IGeL-Angeboten für Ihr persönliches Risikoprofil. Fragen Sie: „Welchen konkreten Mehrwert hätte diese Untersuchung für mich?“
- Nächste Schritte festlegen: Definieren Sie gemeinsam konkrete präventive Maßnahmen (z. B. Ernährungsumstellung, Bewegung) und legen Sie den nächsten sinnvollen Kontrolltermin fest.
Belastungs-EKG, Herzultraschall oder Herz-CT: Welche Untersuchung zeigt was?
Wenn der Standard-Check-up an seine Grenzen stößt oder ein erhöhtes Risiko vorliegt, kommen bildgebende und funktionelle Verfahren ins Spiel. Doch welches Verfahren liefert welche Information? Als Patient ist es entscheidend, den Zweck und die Aussagekraft der wichtigsten Herzuntersuchungen zu verstehen, um gemeinsam mit dem Arzt die richtige Wahl zu treffen. Es geht nicht darum, möglichst viele Untersuchungen durchzuführen, sondern diejenige, die die entscheidende Frage beantwortet.
Das Belastungs-EKG (Ergometrie) ist der Klassiker, um die Reaktion des Herzens auf Anstrengung zu testen. Sie fahren auf einem Standfahrrad oder laufen auf einem Laufband, während Ihre Herzströme abgeleitet werden. Ziel ist es, Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße aufzudecken, die nur unter Last sichtbar werden. Die Echokardiographie (Herzultraschall) hingegen ist ein Blick ins Innere des schlagenden Herzens. Sie liefert präzise Informationen über die Pumpfunktion (Ejektionsfraktion), die Funktion der Herzklappen und die Dicke des Herzmuskels. Sie ist unverzichtbar zur Diagnose von Herzschwäche oder Klappenfehlern.
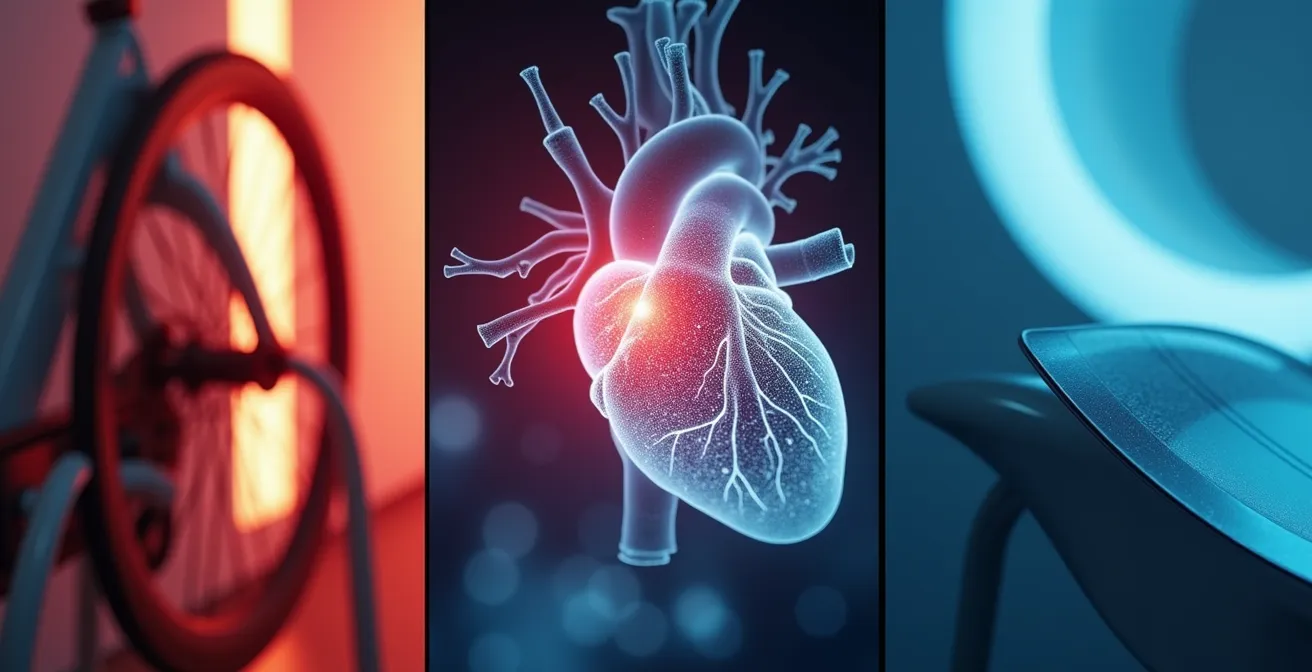
Die modernsten, aber auch teuersten Verfahren basieren auf der Computertomographie (CT). Das Herz-CT zum Kalzium-Scoring misst den Grad der Verkalkung in den Herzkranzgefäßen und gibt so einen Hinweis auf das langfristige Infarktrisiko. Die CT-Koronarangiographie geht noch einen Schritt weiter und kann Engstellen direkt visualisieren, oft mit einer Präzision, die fast an einen Herzkatheter heranreicht. Diese Verfahren sind jedoch speziellen Fällen mit hohem Risiko oder unklaren Befunden vorbehalten.
Die folgende Übersicht, basierend auf Informationen von Fachportalen wie deximed.de zu Belastungs-EKGs, fasst die wichtigsten Aspekte zusammen:
| Untersuchung | Was wird untersucht? | Kassenleistung wenn… | IGeL-Kosten | Aussagekraft |
|---|---|---|---|---|
| Belastungs-EKG | Durchblutung unter Belastung | Verdacht auf KHK | ca. 100€ | 45-50% Sensitivität |
| Herzultraschall | Pumpfunktion, Klappen | Auffälliger Befund | 80-150€ | Sehr hoch für Struktur |
| CT-Kalzium-Score | Verkalkungsgrad | Selten | 100-200€ | Früherkennung gut |
| CT-Koronarangiographie | Engstellen | Konkreter Verdacht | 300-500€ | Sehr präzise |
Die Wahl der richtigen Methode ist eine ärztliche Entscheidung, die auf Ihrem individuellen Risikoprofil beruht. Ein informierter Patient, der die Unterschiede kennt, kann jedoch die richtigen Fragen stellen und die Empfehlungen seines Arztes besser nachvollziehen.
Die unterschätzte Gefahr: Warum Männer ab 45 das Belastungs-EKG nicht auslassen sollten
Während der Check-up 35 eine gute Basis für alle Geschlechter darstellt, gibt es spezifische Risikokonstellationen, die eine differenziertere Betrachtung erfordern. Insbesondere für Männer ab 45 Jahren rückt das Belastungs-EKG in den Fokus – auch wenn sie sich fit fühlen und keinerlei Symptome haben. Der Grund dafür ist biologischer und statistischer Natur: Die koronare Herzkrankheit (KHK) manifestiert sich bei Männern im Durchschnitt etwa zehn Jahre früher als bei Frauen. Ein deutlicher Anstieg der KHK-Häufigkeit ist bei Männern oft schon ab dem 45. Lebensjahr zu beobachten.
Fallbeispiel: Belastungs-EKG-Empfehlungen für asymptomatische Männer
Deutsche medizinische Leitlinien enthalten klare Empfehlungen, die über den reinen Check-up hinausgehen. Sie empfehlen die Durchführung eines Belastungs-EKGs bei asymptomatischen Männern über 40 Jahre, insbesondere bevor diese mit intensivem körperlichem Training beginnen oder wenn sie Berufe mit hoher Verantwortung für die öffentliche Sicherheit ausüben (z.B. Piloten, Busfahrer). Die Untersuchung zielt darauf ab, die maximale Herzfrequenz sicher zu erreichen, welche grob nach der Formel 220 minus Lebensalter berechnet wird. Ein Mann zwischen 45 und 49 Jahren sollte dabei, abhängig von seiner Konstitution, eine Belastung von rund 170 bis 210 Watt erreichen, um eine hohe diagnostische Sicherheit zu gewährleisten.
Diese Empfehlung unterstreicht einen wichtigen Punkt: Das Fehlen von Symptomen ist kein Freifahrtschein. Ein Belastungs-EKG kann verborgene Durchblutungsstörungen des Herzmuskels aufdecken, die in Ruhe nicht sichtbar wären. Es dient als eine Art „Stresstest“ für das Herz-Kreislauf-System und kann frühzeitig Hinweise auf Engstellen in den Herzkranzgefäßen geben, lange bevor diese zu einem Notfall führen. Für Männer in dieser Altersgruppe ist es daher eine der wichtigsten IGeL-Leistungen, um die persönliche „Vorsorgelücke“ zu schließen.
Das Alter bleibt generell der stärkste nicht beeinflussbare Risikofaktor, wie Prof. Dr. Stephan Baldus, Klinikdirektor der Kardiologie an der Uniklinik Köln, im Deutschen Herzbericht betont. Diese Tatsache verdeutlicht, warum eine alters- und geschlechtsspezifische Anpassung der Vorsorge so entscheidend ist.
Die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit ist deutlich erhöht bei der Bevölkerung über 65 Jahre: bei Menschen im Alter von 65 bis 69 Jahren sogar über 60-fach höher als bei 25- bis 29-Jährigen
– Prof. Dr. Stephan Baldus, Deutscher Herzbericht 2025
Für Männer ab 45 bedeutet das: Warten Sie nicht auf Symptome. Sprechen Sie Ihren Arzt proaktiv auf die Möglichkeit eines Belastungs-EKGs an. Es ist eine sinnvolle Investition in die eigene Gesundheit, die im Ernstfall Leben retten kann.
In welchen Abständen sollten Sie Ihre Herzwerte kontrollieren lassen?
Die Frage nach den richtigen Kontrollintervallen lässt sich nicht pauschal beantworten. Die starre Regel „Check-up alle drei Jahre“ ist nur für Personen mit niedrigem Risiko eine ausreichende Leitlinie. Für eine effektive Prävention muss der Abstand der Kontrollen an das individuelle Risikoprofil angepasst werden – eine risikoadaptierte Strategie ist der Schlüssel. Faktoren wie bestehender Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, erhöhtes Cholesterin oder eine familiäre Vorbelastung verkürzen die sinnvollen Intervalle erheblich.
Ein grundlegender Wert, der auch außerhalb des Check-ups regelmäßig überwacht werden sollte, ist der Blutdruck. Bei gesunden Menschen genügt eine jährliche Messung beim Arzt. Liegt jedoch bereits ein Bluthochdruck vor oder bewegen sich die Werte im Grenzbereich, sind engmaschigere Kontrollen, oft sogar eine tägliche Selbstmessung zu Hause, unerlässlich. Die Digitalisierung bietet hier wertvolle Unterstützung. Smartwatches können den Puls kontinuierlich überwachen und auf Unregelmäßigkeiten hinweisen, während spezielle, auf Rezept erhältliche Gesundheits-Apps (DiGAs) beim Management von Bluthochdruck helfen können.
Die folgende Übersicht, die auf Empfehlungen von Krankenkassen wie der KKH basiert, bietet eine Orientierung für einen personalisierten Kontrollplan:
| Risikoprofil | Check-up 35 | Blutdruck | Weitere Kontrollen |
|---|---|---|---|
| Niedrigrisiko (keine Vorerkrankungen) | Alle 3 Jahre | Jährlich beim Arzt | Hautkrebs alle 2 Jahre |
| Mittleres Risiko (1-2 Risikofaktoren) | Alle 3 Jahre | Alle 6 Monate | Belastungs-EKG alle 2 Jahre |
| Hochrisiko (Bluthochdruck bekannt) | Alle 3 Jahre | Täglich zu Hause | Arztkontrolle alle 3-6 Monate |
| Sehr hohes Risiko (KHK/Diabetes) | Jährlich empfohlen | Täglich + DiGA-App | Kardiologe alle 6 Monate |
Diese modernen Möglichkeiten erlauben es, die eigene Gesundheit proaktiv zu managen und nicht nur auf den nächsten Arzttermin zu warten. Durch die Kombination aus ärztlicher Kontrolle und digitaler Selbstüberwachung entsteht ein lückenloses Bild Ihrer Herzgesundheit. Die wichtigsten digitalen Werkzeuge sind:
- DiGA-Apps auf Rezept: Spezielle Apps für Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz helfen, Werte zu dokumentieren und Therapiepläne einzuhalten.
- Smartwatches/Fitnesstracker: Sie ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung von Puls und Herzfrequenzvariabilität und können auf Vorhofflimmern hinweisen.
- Online-Risikorechner: Werkzeuge wie der PROCAM-Score sollten regelmäßig mit aktuellen Werten aktualisiert werden.
- Elektronische Patientenakte (ePA): Sie ermöglicht eine lückenlose Dokumentation aller Befunde für alle behandelnden Ärzte.
Besprechen Sie mit Ihrem Arzt, welche Intervalle und welche digitalen Helfer für Sie persönlich am sinnvollsten sind, um eine passgenaue Vorsorgestrategie zu entwickeln.
Wie Sie sich auf Ihr Belastungs-EKG richtig vorbereiten: Die 6 wichtigsten Regeln
Ein Belastungs-EKG liefert nur dann aussagekräftige Ergebnisse, wenn es unter optimalen Bedingungen durchgeführt wird. Eine gute Vorbereitung Ihrerseits ist daher essenziell und trägt maßgeblich zur Qualität der Diagnose bei. Es geht darum, Störfaktoren zu minimieren und sicherzustellen, dass Ihr Körper die geforderte Leistung erbringen kann. Planen Sie für den gesamten Termin, inklusive Vorbereitung, Test und Nachbesprechung, etwa 30 bis 45 Minuten ein.
Die wichtigste Regel betrifft Ihre Medikation. Insbesondere Medikamente, die die Herzfrequenz senken, wie Betablocker, können das Ergebnis verfälschen, da die Ziel-Herzfrequenz unter Belastung eventuell nicht erreicht wird. Pausieren Sie solche Medikamente jedoch niemals auf eigene Faust, sondern ausschließlich nach ausdrücklicher Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt. Bringen Sie zum Termin unbedingt eine aktuelle Liste aller Medikamente mit, die Sie einnehmen.

Auch Ihre Kleidung und die unmittelbare Vorbereitung spielen eine große Rolle. Bequeme Sportkleidung und feste Sportschuhe sind ein Muss, da Sie sich körperlich anstrengen werden. Ein weiterer, oft übersehener Punkt ist die Hautpflege: Verzichten Sie am Tag der Untersuchung auf das Eincremen des Oberkörpers mit Bodylotion oder Öl, da dies die Haftung der EKG-Elektroden stark beeinträchtigen kann.
Um sicherzustellen, dass Sie nichts vergessen, hier die sechs wichtigsten Vorbereitungsregeln in einer übersichtlichen Checkliste:
- Medikamente: Sprechen Sie das Pausieren von Betablockern oder anderen Herzmedikamenten unbedingt vorab mit Ihrem Arzt ab. Nehmen Sie einen aktuellen Medikamentenplan mit.
- Kleidung: Tragen Sie lockere Sportkleidung und feste, bequeme Schuhe. Bringen Sie eventuell ein Handtuch mit.
- Dokumente: Denken Sie an Ihre Versichertenkarte, den Überweisungsschein (falls vorhanden) und relevante Vorbefunde.
- Ernährung: Eine leichte Mahlzeit bis zu zwei Stunden vor dem Test ist erlaubt und sogar empfehlenswert. Verzichten Sie jedoch auf Kaffee, schwarzen Tee, Cola oder andere koffeinhaltige Getränke am Untersuchungstag.
- Körperpflege: Verwenden Sie keine Cremes oder Lotionen auf Brust, Rücken und Schultern, um eine gute Elektrodenhaftung zu gewährleisten.
- Gesundheitszustand: Führen Sie das Belastungs-EKG nicht durch, wenn Sie akut krank sind (z. B. bei Fieber oder einer Erkältung). Informieren Sie die Praxis rechtzeitig.
Eine sorgfältige Vorbereitung ist der halbe Weg zu einem aussagekräftigen Befund und zeigt Ihrem Arzt, dass Sie ein aktiver Partner im Diagnoseprozess sind.
Wie läuft eine Echokardiographie ab und müssen Sie sich vorbereiten?
Die Echokardiographie, umgangssprachlich auch „Herzecho“ oder Herzultraschall genannt, ist eine der wichtigsten, schmerzfreien und risikolosen Untersuchungen in der Kardiologie. Sie ermöglicht einen direkten Blick auf die Struktur und Funktion des Herzens in Echtzeit. Für die am häufigsten durchgeführte Variante, die transthorakale Echokardiographie (TTE), ist erfreulicherweise keinerlei spezielle Vorbereitung von Ihrer Seite nötig. Sie können vor der Untersuchung normal essen, trinken und Ihre Medikamente wie gewohnt einnehmen.
Bei der TTE liegen Sie mit freiem Oberkörper auf einer Liege, meist in Linksseitenlage, um das Herz näher an die Brustwand zu bringen. Der Arzt trägt ein kühles Ultraschallgel auf Ihre Brust auf und bewegt einen kleinen Schallkopf über die Haut. Das Gel sorgt für eine gute Ankopplung, damit die Ultraschallwellen ungehindert zum Herzen und wieder zurück gelangen können. Die Untersuchung dauert in der Regel nur 15 bis 30 Minuten und ist völlig schmerzfrei. Gemessen werden dabei vor allem drei zentrale Parameter:
- Die Ejektionsfraktion (EF): Sie ist das wichtigste Maß für die Pumpkraft des Herzens und gibt an, wie viel Prozent des Blutes aus der linken Herzkammer bei jedem Schlag ausgeworfen wird. Normale Werte liegen über 55%.
- Die Funktion der Herzklappen: Der Arzt kann beurteilen, ob die Klappen richtig öffnen und schließen oder ob Verengungen (Stenosen) oder Undichtigkeiten (Insuffizienzen) vorliegen.
- Die Struktur des Herzens: Die Dicke der Herzwände und die Größe der Herzhöhlen werden vermessen, was Hinweise auf Schäden durch Bluthochdruck oder andere Erkrankungen geben kann.
Spezialfall: Das „Schluckecho“ (TEE)
In deutschen Kliniken kommt neben der Standard-TTE gelegentlich auch die transösophageale Echokardiographie (TEE), das sogenannte „Schluckecho“, zum Einsatz. Hierbei wird ein dünner Schlauch mit einem Ultraschallkopf an der Spitze durch die Speiseröhre eingeführt. Da die Speiseröhre direkt hinter dem Herzen liegt, ermöglicht dies besonders hochauflösende Bilder von Strukturen, die von außen schwer einsehbar sind. Ein TEE wird zum Beispiel durchgeführt, um kleine Blutgerinnsel im Herzohr vor einer elektrischen Kardioversion auszuschließen. Für diese Untersuchung müssen Sie nüchtern sein und erhalten in der Regel eine leichte Sedierung, ähnlich wie bei einer Magenspiegelung.
Für die große Mehrheit der Patienten bleibt es jedoch bei der unkomplizierten TTE. Sie ist ein schnelles und äußerst aussagekräftiges Werkzeug, um die Gesundheit Ihres Herzens fundamental zu beurteilen.
Das Wichtigste in Kürze
- Der „Check-up 35“ der Krankenkassen ist ein wichtiger Ausgangspunkt, aber keine Garantie für eine lückenlose Herzvorsorge.
- Ihr individuelles Risiko, bestimmt durch Familiengeschichte und spezifische Werte wie Lipoprotein(a), entscheidet über die Notwendigkeit sinnvoller Zusatzuntersuchungen.
- Indem Sie als informierter Patient die richtigen Fragen stellen, werden Sie zum aktiven Partner Ihres Arztes und gestalten Ihre Vorsorge selbst mit.
Wie hoch ist Ihr Herzinfarkt-Risiko: So berechnen Sie es mit dem PROCAM-Score
Nachdem alle relevanten Werte und Befunde aus dem Check-up und eventuellen Zusatzuntersuchungen vorliegen, stellt sich die entscheidende Frage: Was bedeutet das alles zusammen? Wie hoch ist mein persönliches Risiko, in den nächsten zehn Jahren einen Herzinfarkt zu erleiden? Um diese Frage nicht nur aus dem Bauch heraus, sondern auf einer soliden wissenschaftlichen Basis zu beantworten, wurden Risikokalkulatoren wie der PROCAM-Score entwickelt.
Der PROCAM-Score (Prospective Cardiovascular Münster Study) ist einer der etabliertesten und am besten validierten Scores in Deutschland. Er wurde speziell für die Risikobewertung bei Männern und Frauen im mittleren Lebensalter entwickelt. Der Score bezieht acht entscheidende Faktoren in seine Berechnung mit ein:
- Alter
- Geschlecht
- LDL-Cholesterin
- HDL-Cholesterin
- Triglyceride
- Systolischer Blutdruck
- Raucherstatus
- Diabetes mellitus
- Familiäre Vorbelastung (Herzinfarkt bei Verwandten 1. Grades vor dem 60. Lebensjahr)
Durch die Kombination dieser Werte berechnet der Algorithmus die statistische Wahrscheinlichkeit für ein akutes koronares Ereignis innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das Ergebnis wird in drei Risikokategorien eingeteilt: niedrig (<10%), mittel (10-20%) und hoch (>20%). Dieser prozentuale Wert macht das abstrakte Risiko greifbar und dient als exzellente Grundlage für das weitere Vorgehen. Er hilft Ihnen und Ihrem Arzt zu entscheiden, wie aggressiv Risikofaktoren wie Cholesterin oder Blutdruck behandelt werden müssen und welche Kontrollintervalle sinnvoll sind.

Sie können den PROCAM-Score ganz einfach selbst online mit Ihren Laborwerten berechnen. Suchen Sie nach „PROCAM-Score Rechner“, um den Test der Universität Münster zu finden. Betrachten Sie das Ergebnis als wertvolles Werkzeug, um Ihre Situation besser zu verstehen und als motivierenden Startpunkt für präventive Maßnahmen. Es ist wichtig zu wissen, dass dieser Score eine statistische Wahrscheinlichkeit angibt und keine exakte Vorhersage ist. Dennoch ist er ein unverzichtbares Instrument in der modernen, risikoadaptierten Präventionsstrategie.
Die Berechnung Ihres persönlichen Risikos ist der logische Schlusspunkt der Diagnostik und zugleich der Ausgangspunkt für Ihre personalisierte Therapie und Lebensstiländerung. Es ist der Moment, in dem aus Daten und Zahlen ein konkreter Handlungsplan für Ihre Herzgesundheit wird.
Häufige Fragen zur Herzvorsorge
Muss ich für ein normales Herzecho nüchtern sein?
Nein, für die Standard-Echokardiographie (TTE) ist keine Vorbereitung nötig. Sie können normal essen und trinken.
Was wird bei der Echokardiographie genau gemessen?
Die drei wichtigsten Parameter sind: Ejektionsfraktion (Pumpkraft), Funktion der Herzklappen und Dicke der Herzwand.
Ist die Untersuchung schmerzhaft?
Die normale Echokardiographie ist völlig schmerzfrei. Es wird lediglich Gel auf die Brust aufgetragen und der Schallkopf darüber bewegt.
Übernehmen Sie jetzt die Verantwortung für Ihre Herzgesundheit. Nutzen Sie Ihr Wissen aus diesem Leitfaden, um beim nächsten Arztbesuch die entscheidenden Weichen für eine lange und gesunde Zukunft zu stellen.